Identität als politisches Programm? Marxismus und Identitätspolitik
Martin Suchanek. „Wir glauben, dass die tiefgreifendste und potentiell radikalste Politik direkt aus unserer eigenen Identität kommt.“ (Combahee River Collective, 1977).
Dieser Satz stellt eine Art Credo dessen dar, was heute unter „Identitätspolitik“ verstanden wird. Ursprünglich prägten schwarze, antirassistische und antikapitalistische Feministinnen den Begriff. Mittlerweile werden damit Politiken von radikalen Linken, feministischen, reformistischen und bürgerlich-liberalen Kräften oder auch des Rechtspopulismus gefasst.
Mit der Ausweitung der Phänomene, Strömungen und gesellschaftlichen Kräfte, die mit dem Terminus bezeichnet werden, geht eine zunehmende Unbestimmtheit einher, die noch dadurch vermehrt wird, dass Identitätspolitik mittlerweile zu einem Kampfbegriff geworden ist.
Annäherung an eine erste Definition
Bevor wir diese Entwicklung kurz nachzeichnen und die Frage diskutieren, warum mittlerweile gegensätzlichen Klassenkräften dieses Label zugeschrieben wird, wollen wir darstellen, was diese Politik von Beginn an auszeichnet. Aus obigem Zitat wird deutlich, dass der Begriff der eigenen Identität als entscheidende Grundlage einer radikalen Politik zur Befreiung oder zur Beseitigung von Ungerechtigkeit und Benachteiligung reklamiert wird.
Identität stellt dabei das individuelle oder kollektive Bewusstsein vor, das aus der eigenen oder gemeinsam geteilten Erfahrung entsteht. Darauf basiere die radikalste Politik im Interesse der jeweiligen Gruppe von ausgebeuteten, unterdrückten und diskriminierten Menschen. „Die“ Frauen, „die“ Schwarzen, „die“ ArbeiterInnen teilten nicht nur gemeinsame Erfahrungen. Sie würden damit auch über einen Zugang zur Erkenntnis der Ursachen und der Politik zur Überwindung der Lage von Ausgebeuteten oder Unterdrückten verfügen, der Nicht-Angehörigen dieser Gruppe prinzipiell verwehrt ist. Dies ergibt sich logisch daraus, dass die jeweils eigene Identität zur Quelle für die „tiefgreifendste und potentiell radikalste Politik“ erklärt wird.
Die Erklärung des Combahee River Collective bringt das direkt zum Ausdruck. Die Erfahrung mit dem Rassismus weißer Mittelschichtfrauen im Feminismus der 1970er Jahre und mit männlichem Chauvinismus sowie Sexismus in der Black Community einschließlich radikaler linker Organisationen wie der Black Panther Party führen sie zur Schlussfolgerung:
„Wir erkennen, dass die einzigen Menschen, die sich genug um uns kümmern, um konsequent für unsere Befreiung zu arbeiten, wir selbst sind. Unsere Politik entwickelt sich aus einer gesunden Liebe zu uns selbst, unseren Schwestern und unserer Gemeinschaft, die es uns erlaubt, unseren Kampf und unsere Arbeit fortzusetzen.“
Diese jeweils eigene Identität wird zum privilegierten Ort von Radikalität und Erkenntnis. Nicht-Angehörige der jeweils betroffenen Gruppe können Unterdrückung zwar nachzuempfinden und nachzuvollziehen versuchen, aber sie können nie selbst auf die gleiche Weise aus dieser Erfahrung als „Frau“, „Schwarze“ (oder auch als „Arbeiterin“) schöpfen.
Sobald dieses Verständnis von Erfahrung – Identität – Politik akzeptiert wird, befinden wir uns auf dem Boden der Identitätspolitik.
Sobald die Grundlagen der Identitätspolitik akzeptiert werden und diese selbst zu einer bestimmenden Ideologie politischer Strömungen wird, entfalten sich daraus auch deren innere Widersprüche. Sie manifestieren sich gerade mit ihrem Siegeszug z. B. in weiten Teilen der Frauenbewegung, in der „radikalen“ Linken, aber auch durch ihre Akzeptanz im bürgerlichen Politikbetrieb. Im Folgenden wollen wir diese Entwicklung nachzeichnen.
Entstehung
Geprägt wurde der Begriff der Identitätspolitik vom Combahee River Collective, einer 1974 gegründeten Organisation schwarzer Feministinnen. In ihrem Statement von 1977 arbeiten sie nicht nur ihre Erfahrungen als unterdrückte schwarze, heterosexuelle und lesbische Frauen auf, sondern auch die Reproduktion von Rassismus im von weißen Mittelschichtfrauen dominierten Feminismus, die Reproduktion von Sexismus durch die Männer der antirassistischen Bewegung.
Im Gegensatz zu den meisten späteren VertreterInnen von „Identitätspolitik“ verstand sich das Combahee River Collective als revolutionäre Organisation. Ähnlich wie die von Claudia Jones schon Ende der 1940er Jahre formulierte Triple Oppression Theory (TOT) begriff es die kapitalistische Ausbeutung, Patriarchat und Rassismus als die Gesellschaft prägenden und damit auch revolutionär zu überwindenden Strukturen.
Für das Combahee River Collective stellte die Herausbildung einer „radikalen“, revolutionären Identität der Unterdrückten eine spontane Tendenz dar, sofern und sobald diese ihre gemeinsamen Erfahrungen im Rahmen kollektiven Austauschs ihrer Probleme und gemeinsamer Organisierung zu artikulieren beginnen. Diese Verkürzung wird angesichts der geschichtlichen Lage der frühen 1970er Jahre verständlich. Seit der Bürgerrechtsbewegung war die Lage der rassistisch Unterdrückten in den USA von einem politischen Erwachen, dem Anwachsen einer Massenbewegung und deren Radikalisierung bis hin zur Black Panther Party geprägt. International bildeten nationale und antikoloniale Befreiungskämpfe bis hin zum Sieg Vietnams gegen die USA einen historischen Hintergrund, der nicht nur Anlass zu revolutionärem Optimismus gab, sondern auch die Vorstellung nährte, dass die Unterdrückten – und hier zuerst die am meisten Unterdrückten – spontan zu revolutionärem Bewusstsein gelangen würden.
Zugleich steht das Combahee River Collective ironischerweise auch für eine Kritik an der Identitätspolitik, die die Frauenbewegung prägte (insbesondere den radikalen Feminismus). Das Statement von 1977 weist mit scharfer Kritik auf die widersprüchliche Lage in den Bewegungen der Unterdrückten selbst hin, darauf, dass in der von weißen Mittelschichtfrauen dominierten feministischen Bewegung Rassismus reproduziert wird, die antikolonialen und antirassistischen Bewegungen vor allem von Männern (und oft von solchen aus der Intelligenz) dominiert wurden, in der ArbeiterInnenklasse weiße, ältere Männer Politik und Ausrichtung bestimmten.
Das Statement stellte damit auch eine Reaktion auf die Reproduktion sozialer Unterdrückung in der ArbeiterInnenklasse und unter den Unterdrückten wie auf die Blindheit linker Kräfte gegenüber dieser Tatsache dar. Auch wenn in der bürokratisch dominierten ArbeiterInnenbewegung und in nationalen Befreiungsbewegungen ähnliche Mechanismen wie in der radikalen sowie in der bürgerlichen Frauenbewegung seit Ende der 1960er Jahre wirken, so wurde der Begriff der Identitätspolitik lange Zeit vor allem auf Letztere angewandt.
Ein bedeutender Unterschied zu späteren Kritiken z. B. des Queerfeminismus besteht darin, dass diese radikale Strömung des Feminismus oder Antirassismus die Bildung einer kollektiven Identität bzw. einer Massenbewegung zur Beseitigung der strukturellen Ursachen der Unterdrückung zum Ziel hatte.
Ausweitung der „Identitätspolitik“
Die Ausweitung der Identitätspolitik in der Frauenbewegung und im Feminismus ging, wie auch in Bewegungen gegen rassistische Unterdrückung, zugleich oft (und wohl auch entgegen den Intentionen mancher ihrer SchöpferInnen) damit einher, dass die „gemeinsame Identität“ als klassenübergreifende vorgestellt wurde. Der radikal antikapitalistische und antiimperialistische Anspruch geht in den 1970er und 1980er Jahren mit der Verbreitung der Identitätspolitik rasch verloren, sofern er überhaupt je existierte. Verstärkt wird er durch die Niederlagen der ArbeiterInnenklasse im Zuge der neoliberalen Offensive und der Restauration des Kapitalismus, die gerade für die Intelligenz als „Ende des Marxismus“ erscheint. Für die Identitätspolitik existiert faktisch die Einheit „der Frauen“ oder „der Schwarzen“ als klassenübergreifende gegenüber „den Männern“ oder „den Weißen“, unabhängig von ihrer Klassenzugehörigkeit.
Dies unterstellt eine gemeinsame Erfahrung „aller“ Frauen (oder „aller“ Unterdrückten). Wir wollen hier keineswegs bestreiten, dass es tatsächlich gemeinsame Unterdrückungserfahrungen gibt, die die Angehörigen aller Klassen betreffen. Zugleich finden wir aber auch erhebliche Unterschiede. Entscheidend ist jedoch, dass auf Basis der Identitätspolitik die grundlegenden Gegensätze zwischen Frauen aus der herrschenden Klasse und der ArbeiterInnenklasse ebenso wie die Sonderinteressen der Frauen aus dem KleinbürgerInnentum und den lohnabhängigen Mittelschichten hintangestellt werden. Es ist auch kein Zufall, dass die VertreterInnen von Identitätspolitik oft aus letzteren Klassen bzw. Schichten stammen. Deren Lage zwischen den Hauptklassen der kapitalistischen Gesellschaft bildet einen sozialen Nährboden für die Ausbreitung von Ideologien, deren Gehalt in der Verwischung der Klassengegensätze besteht.
Dabei treten die inneren Gegensätze im realen Leben und gerade auch in Massenbewegungen mit Macht hervor. So im „Women’s March“ gegen Trump 2017. Tamika Mallory, eine linke Aktivistin und Vertreterin von Black Lives Matter, wurde des „Antisemitismus“ beschuldigt, weil sie sich mit dem palästinensischen Widerstand solidarisierte und an einer Veranstaltung der Nation of Islam teilnahm. Trotz klarer Beweise dafür, dass sie gegen Antisemitismus in der Black Community auftrat, verstummten die Anschuldigungen nicht und es folgte schließlich eine Spaltung der Koordinierung.
In ihrer Verteidigung machte Mallory auf einen Punkt aufmerksam, der die Doppelstandards ihre KritikerInnen verdeutlichte. Während sie sich ständig für einen Auftritt bei der Nation of Islam rechtfertigen müsse, wurde z. B. die Republikanerin Meghan McCain nie gefragt, ob sie sich von der Politik ihrer Partei oder frauenfeindlichen Äußerungen ihres Vaters distanziere. Im Gegenteil: Sie wurde willkommen geheißen, weil sie als prominente Republikanerin die Bewegung verbreiten, Mallory mit ihrem Antizionismus und Antikolonialismus hingegen „die Frauen spalten“ würde.
Hinter dieser Konzeption wird deutlich, dass „identitätspolitische“ Einheit, die Einheit „aller“ Frauen unabhängig von Klassenzugehörigkeit und Unterdrückung nur ein ideologischer Deckmantel für die Durchsetzung besonderer, in der Regel bürgerlicher oder kleinbürgerlicher Klasseninteressen darstellt.
Dieses Beispiel verweist auch schon darauf, dass die Identitätspolitik in den letzten Jahrzehnten eine weit über die ursprüngliche Frauenbewegung hinausgehende Bedeutung erfahren hat und Eingang in die bürgerliche Öffentlichkeit fand.
Eine „(neo)liberale“ Identitätspolitik, die vor allem die besonderen Interessen der Frauen aus den Mittelschichten, dem KleinbürgerInnentum und z. T. auch aus der ArbeiterInnenaristokratie artikulierte, wurde von bürgerlichen und reformistischen Parteien aufgegriffen, um diese Frauen oder in analoger Weise auch andere Unterdrückte als WählerInnen zu gewinnen.
Linke Feministinnen wie Nancy Fraser oder im Manifest „Feminismus für die 99 %“ unterzogen diesen „liberalen Feminismus“ einer scharfen Kritik, der faktisch eine Allianz mit Vertreterinnen des „aufgeklärten“ Kapitalismus auf dem Rücken der proletarischen „weißen“ Männer, aber auch aller anderen subalternen Schichten und Klassen geschlossen habe. Damit hätte er Trump und dem Rechtspopulismus erleichtert, sich als Vertretung der „arbeitenden Klasse“, der „hart arbeitenden AmerikanerInnen“ auszugeben.
Dieser durchaus berechtigte Vorwurf greift aber zu kurz. Während Fraser die Folgen und die politische Kapitulation eines liberalen Feminismus entlarvt, greift sie nicht die jeder Identitätspolitik zugrundeliegende Vorstellung an, dass die eigene Erfahrung direkt zu fortschrittlichem, befreiendem und gesellschaftsveränderndem Bewusstsein führen würde. Im Gegenteil, das Manifest „Feminismus für die 99 %“ durchziehen selbst identitätspolitische Vorstellungen, namentlich wenn die Bildung eines gesellschaftsverändernden „revolutionären“ Subjekts selbst als Allianz verschiedener Klassenfraktionen der Subalternen und der Unterdrückten, also als Addition kollektiver Identitäten, verstanden wird (eine ausführliche Kritik findet sich in Urte March, Feminismus für die 99 Prozent – eine Kritik, in: Fight 8, März 2020).
Veränderung der Klassenbasis
Die Erweiterung des Begriffs gegenüber den 1970er Jahren reflektiert eine Veränderung der Klassenbasis von Identitätspolitik. Ursprünglich stellte sie eine kleinbürgerliche Ideologie dar, die aus Bewegungen von Unterdrückten hervorging und eine, aus der gemeinsamen Erfahrung gewonnene Einheit im Kampf begründen sollte – auch in Abgrenzung zu anderen Unterdrückten oder Ausgebeuteten, die eine vergleichsweise privilegierte Stellung in der Gesellschaft innehatten.
Die frühen, identitätspolitisch geprägten Gruppierungen, Bündnisse und Bewegungen gingen oft mit einer ideologischen Tendenz zur „Essentialisierung“ des Unterdrückungsverhältnisses einher. Diese drängt sich geradezu auf, wenn die Identität der Unterdrückten direkt der gemeinsamen Erfahrung entspringen soll. Diese scheint dann nicht in einem historisch konstituierten gesellschaftlichen Verhältnis zu stehen, sondern als „Eigenschaft“ einer bestimmten Gruppe von Menschen, die im Extremfall biologisch, natürlich oder durch gemeinsame Kultur, Lage usw. spontan produziert wird.
Daher können Frauen z. B. als das „friedliche“ Geschlecht erscheinen, das von Haus aus „verständigungsorientierter“ sei. Die Tendenz zur Naturalisierung liegt der Identitätspolitik zugrunde, weil ihr die Identität (bzw. das bürgerliche Individuum) selbst als etwas „Natürliches“ erscheint, als Grundkonstante, als ein vorgefundenes Wesen des/der Unterdrückten.
Dies trifft auch auf radikalere Teile der Frauenbewegung zu, die ihre Politik oft genug mit einer „Essentialisierung“ der gemeinsamen Erfahrung begründen. So lassen sich auch die heftigen Konflikte jener Teile des Feminismus, die ein essentialistisches Verständnis des natürlichen Geschlechts und der Geschlechteridentität („Frauen sind Frauen“) vertreten, mit Trans-AktivistInnen verstehen. Auf der Basis von Identitätspolitik sind diese Gegensätze letztlich nicht auflösbar.
Solange der/die TrägerIn der Identität nicht als Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse, sondern als vereinzeltes bürgerliches Individuum oder als Gruppe von Individuen verstanden wird, die gemeinsame Eigenschaften und Erfahrungen teilen, erscheint Identität als ein unhinterfragbares Absolutes. Wer nichts besitzt, besitzt immerhin, so scheint es, seine eigene Identität.
Natürlich wohnt der Suche nach ihr und dem Austausch gemeinsamer Erfahrungen auch ein wichtiges emanzipatorisches Moment inne, ohne das es keine fortschrittliche oder revolutionäre politische Bewegung geben kann. Aber zugleich müssen die Grenzen dieser Suche verstanden werden.
Wird die Identität als Ort privilegierter Erfahrung und Wahrheit gesetzt, so ergibt sich für jede darauf begründete Politik eine Tendenz zur Verabsolutierung der jeweils individuellen oder Gruppenerfahrung „der“ Frauen, „der“ Schwarzen, aber auch „der“ FabrikarbeiterInnen usw. usf.
Wird die eigene oder kollektive Erfahrung zum entscheidenden Kriterium für Wahrheit und Richtigkeit von Politik, so lässt sich über diesen Wahrheitsanspruch und die daraus abgeleitete Politik letztlich nicht vernünftig streiten. Verschiedene Ansprüche stehen einander mit gleichem Recht auf Authentizität entgegen. Jedes Infragestellen des unbedingten Anspruchs auf die Richtigkeit der eigenen Erfahrung und Wahrnehmung erscheint notwendigerweise als eine Relativierung der sich erhebenden Identität der/des Betroffenen.
Die Verabsolutierung der eigenen Erfahrung tritt uns in verschiedenen Formen entgegen, z. B. im Konzept von Definitionsmacht, dem zufolge allein die Beschuldigung von TäterInnen durch Opfer physischer oder verbaler Übergriffe auf Unterdrückte definiert, ob eine solche Tat auch vorlag – im Grunde ein Rückfall hinter das bürgerliche Recht, weil Beschuldigten oder TäterInnen jedes Recht auf Verteidigung genommen wird. Die rechtliche oder gesamtgesellschaftliche Problematik ist offenkundig. Sie zeigt sich außerdem auch schlagend, sobald verschiedene Unterdrückte auf ihre jeweilige Definitionsmacht absolut pochen, wenn also z. B. ein rassistisch unterdrückter Mann einer weißen Frau Rassismus vorwirft, diese wiederum dem Mann Sexismus.
Noch weitaus problematischer wird es, wenn die eigene Unterdrückungserfahrung zum entscheidenden Wahrheitskriterium für die Richtigkeit von Politik gemacht wird. Über die Politik einer nationalen Befreiungsbewegung könnten demzufolge Menschen aus den Metropolen, die keine Angehörigen der unterdrückten Nation sind, nicht „von außen“ urteilen. Dies käme einer typisch westlichen, kolonialistischen Arroganz gleich. Lassen wir einmal beiseite, dass auch die Solidarisierung mit einer Befreiungsbewegung (oder erst recht mit einer bestimmten politischen Strömung) ein Urteil „von außen“ impliziert, so läuft diese identitätspolitische Vorstellung regelmäßig auf eine Immunisierung vor Kritik hinaus. Und diese begünstigt unwillkürlich die dominierenden bürgerlichen Klassenkräfte innerhalb dieser Bewegungen.
In extremer Form schlägt die Identitätspolitik in einen Relativismus um, der den Kampf gegen reaktionäre Ideologien und Organisationen unter den Unterdrückten ablehnt oder deren repressiven Charakter verharmlost. Vom Standpunkt revolutionärer Klassenpolitik aus bedeutet eine Akzeptanz der Identitätspolitik in der Frauenbewegung eine Anpassung an kleinbürgerliche und bürgerliche, zumeist feministische Ideologien, bei nationalen Befreiungsbewegungen an verschiedene Spielarten des Nationalismus. Kurzum, der mit der Identitätspolitik einhergehende Relativismus führt unwillkürlich zur politischen Unterordnung des Proletariats unter kleinbürgerliche, bürgerliche, im Extremfall sogar direkt reaktionäre Klassenkräfte.
Linke Lösungsversuche
Diese Problemstellungen greifen linke VerteidigerInnen der Identitätspolitik wie Lea Susemichel/Jens Kastner in ihrem Buch „Identitätspolitiken“ auf und versuchen, eine „relativierte“ Identitätspolitik zu begründen, die diesen Fehler vermeiden soll.
Einerseits nehmen sie eine Erweiterung des Begriffs vor, indem sie faktisch jede Massenpolitik, jede Bewegung als eine Form von Identitätspolitik interpretieren, weil diese immer auf ein kollektives Wir verweisen müsse, auf eine gemeinsame Lage, Erfahrung und GegnerInnen, um eine gemeinsame politische oder gesellschaftliche Kraft zu konstituieren.
So erscheint für Susemichel/Kastner die ArbeiterInnenbewegung als eine neue, organisierte Massenbewegung, als erste, globale Form der Identitätspolitik. Neben dieser fortschrittlichen Urform (Identifikation mit der Klasse statt mit der Nation) steht für sie am anderen Pol eine rechte Identitätspolitik wie z. B. der Populismus eines Trump.
Wenn alles Identitätspolitik ist, diese also als Bedingung des Politischen erscheint, wird der Begriff freilich inflationär und nichtssagend. Wohl müssen wir uns fragen, warum so diese verschiedenen politische Bewegungen und Ideologien überhaupt als „Identitätspolitik“ erscheinen können. Der Grund dafür liegt nicht einfach darin, dass Bewegungen auch auf gemeinsame Erfahrungen rekurrieren sowie auf ein gemeinsames Wir oder eine/n gemeinsamen (Klassen-)GegnerIn.
Der Punkt für die Überlappung von rechter und linker Identitätspolitik liegt vielmehr im Versuch, die Politik einer Bewegung, ihr Programm, ihre Forderungen usw. aus dieser scheinbar unmittelbar vorgefundenen Identität herzuleiten. Er rekurriert dabei auf eine wirkliche oder angebliche gemeinsame Erfahrung aller Frauen, Weißen, Unterdrückten, die zu einer „natürlichen“ Gemeinsamkeit verklärt wird.
Auch wenn alle diese Bewegungen Momente von Identitätspolitik enthalten, so wirft die Charakterisierung politischer Strömungen unter diesem Label eigentlich mehr Probleme auf, als sie löst. Wenn Bewegungen und politische Kräfte, die sich auf unterschiedliche Klassen (oder Teile von Klassen) stützen, zusammengeworfen werden, wird der Begriff entweder nichtssagend oder er verwischt die eigentlich grundlegenden Unterschiede zwischen diesen Bewegungen, vor allem ihren Bezug auf die verschiedenen Klassen der Gesellschaft.
Die Frage müsste also vielmehr lauten, warum Nationalismus, Populismus, Feminismus, Ökonomismus so leicht mit identitätspolitischen Vorstellungen verknüpft werden können. Der Grund liegt darin, dass diese Ideologien allesamt mit dem Rekurs auf eine angebliche gemeinsame Identität oder Erfahrung die ArbeiterInnenklasse sowie gesellschaftlich Unterdrückte bürgerlichen Kräften unterordnen. Dies verdeutlicht einmal mehr den grundsätzlich reaktionären Charakter der Identitätspolitik.
Vorläufer und historische Bezugspunkte linker Identitätspolitik
Die VertreterInnen einer „linken“ Identitätspolitik versuchen, die Probleme, die mit deren „Essentialisierung“ einhergehen, durch die Begründung einer nicht-essentialistischen Identitätspolitik zu lösen. Ihre Bemühungen knüpfen dabei an historische Vorbilder wie Simone de Beauvoir oder an Frantz Fanon an, die wir im Folgenden untersuchen werden, um zu verdeutlichen, dass auch diese Spielart der Identitätspolitik ihren inneren Problemen nicht entkommen kann.
De Beauvoir
In ihrem Werk „Das andere Geschlecht“ kommt de Beauvoir das Verdient zu, radikal „das Frausein“ in Frage zu stellen. „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“, fasst sie zusammen. Damit verweist sie – ähnlich wie die marxistisch-materialistische Erklärung der Frauenunterdrückung – darauf, dass Geschlechterrollen, das „Frausein“, weibliche Sexualität (bzw. deren Verleugnung) keine „natürlichen“, angeborenen Eigenschaften „der Frau“, sondern gesellschaftliche Phänomene darstellen.
Auch wenn de Beauvoir nicht die Erste war, die auf die gesellschaftliche Konstitution der Geschlechterrollen und Identitäten hingewiesen hat, so liegt die Bedeutung ihres Buchs darin, diese markant und für Millionen Frauen hervorgehoben zu haben.
Aber aufgrund ihrer philosophischen Grundlage, des Existenzialismus, kann sie das Wesen „des Menschen“ nur individualistisch und abstrakt fassen. Für sie geht (wie für Sartre und andere) die Existenz „des Menschen“ seinem gesellschaftlichen Wesen voraus; d. h. das Individuum wird ontologisch als Mensch verstanden, der in die Welt geworfen, zum Individuum gemacht wird, indem er gezwungen ist, sich zu entscheiden. Der Mensch ist, wofür, wozu er sich entscheidet. Bei de Beauvoir ist dies eng mit dem Streben nach Freiheit verbunden.
Damit greift sie zwar ein reales Moment menschlichen und insbesondere politischen Handelns auf, das notwendig Entscheidungssituationen hervorbringt. Aber sie abstrahiert von der historischen Bestimmtheit dieses Entscheidens und des Strebens nach Freiheit. „Entscheidung“ und „Freiheit“ werden nicht mehr als historisch konstituierte und wandelbare Größe begriffen, sondern als Grundeigenschaften „des Menschen“.
In de Beauvoirs Arbeiten werden zwar immer wieder die Grenzen dieser abstrakten Bestimmungen des für sich existierenden Individuums deutlich. Aber ihr philosophischer Ausgangspunkt lässt in sie gesellschaftliche und historische Faktoren nur im Nachhinein einfließen. Diese relativieren zwar die grundlegenden Fehler des Existenzialismus, aber ohne dessen eigentliche Grundlagen zu überwinden, nämlich „Freiheit“ oder „Entscheidung“ nicht als historische, sich entwickelnde Phänomene zu begreifen, die mit der Entwicklung der Gesellschaftsformationen und der Produktivkräfte selbst erst entstehen und einem Veränderungsprozess unterzogen sind.
Diese Probleme tauchen in jeder „nicht-essentialistischen“ Identitätspolitik auf wie auch im Queer- und Differenzfeminismus. Um den Fallstricken des „Essentialismus“ zu entgehen, nehmen Letztere zum subjektiven Idealismus Zuflucht. Frau, Geschlecht, Identität erscheinen als rein diskursive Konstruktionen, in denen „die Frau“ oder „das Geschlecht“ „gemacht“ wird. Der Preis für diese „Lösung“ besteht freilich darin, dass jede kollektive Identität per se suspekt und tendenziell repressiv wird. Differenz- oder Queerfeminismus führen daher politisch logisch zu einer rein idealistischen, individualistischen Politik – Identität selbst ist eine Konstruktion. Oder anders formuliert: Auf Grundlage einer Dekonstruktion eines scheinbar natürlichen Wesens kann nur eine rein individuell, negativ bestimmte Identität von Unterdrückten hergeleitet werden. Befreiung wird damit ihrer kollektiven Aspekte entkleidet und wesentlich auf Selbstbestimmung, Selbstermächtigung des Individuums und auf Verschiebung von Diskursen, also Sprachpolitik konzentriert. Der Queer- und Differenzfeminismus mit seinem Fokus auf das Individuum stellt dabei nicht nur eine reaktionäre, idealistische Konzeption dar. Diese Ideologie entspricht zugleich der Klassenlage der Mehrzahl ihrer VertreterInnen unter den lohnabhängigen Mittelschichten (v. a. den akademisch ausgebildeten).
Grenzen
Die „nicht-essentielle“ Identitätspolitik hingegen will nicht nur dem Problem des „Essentialismus“, sondern auch des bürgerlichen Individualismus entgehen. Sie greift daher – wie der „Essentialismus“ – auf eine gemeinsame Erfahrung als Grundlage für gemeinsame Politik zurück. Dessen Fehler und Tendenzen zur Verabsolutierung sollen aber durch Reflexion auf ihre möglichen, andere Unterdrückte „ausschließenden“ Momente der eigenen Identität vermieden werden. Dazu wurde eine ganze Reihe von Techniken entwickelt, darunter der Intersektionalismus, eine Art Reparaturbetrieb auf Grundlage der Identitätspolitik.
Das Problem, das bei der Begründung einer „nicht-essentialistischen“ Identitätspolitik immer wieder auftaucht, hängt mit Folgendem zusammen. Um die Identität einer Massenbewegung zu begründen, reicht eine rein abstrakte, bloß negative oder rein diskursive Bestimmung der Identität nicht aus. Eine kollektive Identität muss also an der Wirklichkeit ansetzen. Dazu soll die gemeinsame Erfahrung herhalten. Doch die Erfahrung selbst stellt sich in der bürgerlichen Gesellschaft als widersprüchliche dar. Auch jene der Unterdrückung (oder erst recht des „Ausgebeutet-Seins“) bringt die realen gesellschaftlichen Verhältnisse keineswegs unmittelbar zum Ausdruck, sondern auf eine ideologisierte, die realen Verhältnisse teilweise sogar auf den Kopf stellende oder verschleiernde Weise.
Wenn bei Bildung einer kollektiven Identität unmittelbar aus der eigenen Erfahrung ein sich befreiendes Subjekt abgeleitet werden soll, entsteht unwillkürlich die Tendenz, dass auf gesellschaftlich vorherrschende Formen des Bewusstseins der Unterdrückten zurückgegriffen wird. Dass z. B. auch der Masse der Frauen die Familie als „natürliche“ und wünschenswerte Form des Zusammenlebens erscheint, entspringt den gesellschaftlichen Verhältnissen im Kapitalismus selbst (ganz so wie den WarenbesitzerInnen die Warenproduktion als natürlich erscheint).
Wir wollen das an einem Beispiel verdeutlichen. Im Kapitalismus wird der größte Teil der Reproduktionsarbeit von Frauen geleistet. Diese geschlechtsspezifische Arbeitsteilung führt dazu, dass sie nicht nur dementsprechende Fähigkeiten und darauf aufbauende Bewusstseinsformen stärker ausbilden als Männer. Weil diese Arbeitsteilung über Generationen, ja in unterschiedlicher Form die gesamte Geschichte der Klassengesellschaften prägt, erscheint es so, dass Frauen nicht nur „von Natur“ aus besser für Reproduktions- und Sorgearbeiten geeignet wären, sondern auch mit dieser verbundene Haltungen gegenüber anderen Menschen „natürlich“ einnähmen. Sie wären sorgender, mitfühlender, kooperativer, friedfertiger, kompromissbereiter … Ein auf Identitätspolitik basierender Feminismus greift zwar durchaus die in der bürgerlichen Gesellschaft vorherrschenden Rollenzuschreibungen und Ungleichheiten der Geschlechter an, er übernimmt aber auch bestimmte scheinbar natürliche Charaktereigenschaften „der“ Frau. Statt diese als Resultate einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zu begreifen, werden diese auch in der Identitätspolitik als natürliche Eigenschaften der Frau reklamiert, allerdings positiv konnotiert. So sollten Frauen mehr bestimmen, weil sie das an sich friedfertigere, solidarischere, sorgendere Geschlecht seien.
Die „nicht-essentialistische“ Identitätspolitik begreift zwar dieses Problem. Sie erkennt, dass die identitätspolitischen Bewegungen gesellschaftlich Unterdrückter an einen toten Punkt angelangten, wenn verschieden Unterdrückte (z. B. „die Frauen“, „die rassistisch Unterdrückten, „die Jugend“) ihre Unterdrückung gegenüber anderen jeweils absolut setzten. Aber die Begrenzung gegenüber der Absolutheit durch Vermittlung zwischen den Bewegungen und Reflexion der eigenen „blinden Flecken“ greift in Wirklichkeit zu kurz.
Ihr gerät nämlich der ideologische, widersprüchliche, verkehrte Charakter der „spontanen“ Identität der Unterdrückten selbst aus dem Blick. Um die Grenzen der Identitätspolitik zu sprengen und zugleich eine Massenbewegung (z. B. von proletarischen Frauen oder von rassistisch Unterdrückten) aufzubauen, reicht es nicht aus, die ausgrenzenden Tendenzen „spontaner“ identitätspolitischer Bewegungen einzuhegen. Es muss vielmehr die Vorstellung problematisiert werden, dass die eigene Erfahrung von Unterdrückung spontan zur richtigen Erkenntnis der Ursachen und Wege zur Überwindung der Unterdrückung führen könnte.
Frantz Fanon
Dies wollen wir auch an einem zweiten Vorbild der „nicht-essentialistischen Identitätspolitik“ verdeutlichen: Franz Fanon. In seiner Schrift „Die Verdammten dieser Erde“ übt er immer wieder scharfe Kritik an der Anpassung der schwarzen Intelligenz an koloniale Herrschaft und bürgerlich-demokratische Ideologien, aber auch an einen schwarzen Nationalismus, der die traditionellen afrikanischen Gesellschaften romantisiert und deren Vergangenheit neu beleben möchte. Fanon selbst charakterisiert dies als reaktionäre und folkloristische Sentimentalität, als Ablenkung vom Kampf um Befreiung.
In diesem Sinn ist Fanon „anti-essentialistisch“. Aber um eine Massenbewegung im antikolonialen Befreiungskampf zu begründen, greift er nicht zum Marxismus und zu Trotzkis Theorie der permanenten Revolution, die allein den Kampf um demokratische Rechte und die sozialistische Revolution theoretisch und programmatisch zu verbinden vermag. Er steht vielmehr in der Tradition des sowjetrussischen Stalinismus und Maoismus und der von ihnen geprägten Etappentheorie, der zufolge die Revolution in den Halbkolonien zuerst zur nationalen Befreiung führen muss, bevor die sozialistischen Aufgaben angegangen werden können.
Er verleiht ihr freilich noch eigene Elemente. Erstens gilt Fanon die städtische ArbeiterInnenklasse in den Kolonien als eine gekaufte, eng mit dem Kolonialismus verbundene Klasse, und sie scheidet somit als revolutionäre Kraft aus, ja mag wie große Teile der städtischen Bevölkerung als rückschrittlich erscheinen. Kein Wunder also, dass er die revolutionäre Kraft eher auf dem Land als in den Zentren sucht und der von dort aus organisierte Befreiungskampf favorisiert wird.
Zweitens trennt er scharf zwischen der „nationalen Kultur“, wie sie vorgefunden wird, von der „Nation“, wie sie im Befreiungskampf erst begründet wird, am Entstehen ist. Wie ein Phönix aus der Asche erhebt sich ein nationales Bewusstsein, das für ihn auch die höchste Form revolutionären Bewusstseins darstellt.
„Die internationalen Ereignisse, der um sich greifende Zusammenbruch der Kolonialreiche, die Widersprüche innerhalb des kolonialistischen Systems unterhalten und verstärken die Kampfbereitschaft, lassen ein nationales Bewusstsein entstehen und geben ihm Kraft.“ (Fanon, Die Verdammten dieser Erde, suhrkamp, Frankfurt/Main 1981, S. 202)
Und weiter: „Wenn die Kultur eine Äußerung des Nationalbewusstseins ist, so zögere ich für unseren Fall nicht zu sagen, dass das Nationalbewusstsein die am meisten entwickelte Form der Kultur ist.“ (Ebenda, S. 208)
Er versucht, einen „revolutionären Nationalismus“ zu begründen, der ihm zufolge qualitativ anders als der Nationalismus alter Prägung sei, insofern er eine „internationale Dimension“ besitze. Anders als der Marxismus, der auch den Nationalismus der unterdrückten Nationen als bürgerliche Ideologie betrachtet und kritisiert und daher den Kampf um nationale Befreiung scharf von allen Zugeständnissen an den Nationalismus abgrenzt, imaginiert Fanon einen „internationalen“ Befreiungsnationalismus. Für diesen will er in der Realität Anknüpfungspunkte finden, ihn aus den „positiven“ Traditionen des nationalen Kampfes ziehen. Im konkreten Fall des Befreiungskampfs in Algerien waren dies die linke, bürgerlich-nationalistische Befreiungsfront FLN und die entstehende panafrikanische Bewegung.
Die Verallgemeinerung einer aus unmittelbaren Erfahrungen gewonnenen „Identität“, selbst wenn sie sich von Beginn an von problematischen hergebrachten Formen abgrenzt, führt also auch bei Fanon dazu, dass er auf eine reale, vorgefundene, von der Gesellschaft geprägte Identität zurückgreifen muss.
Für die Bildung eines kollektiven Subjekts reicht auch beim „Befreiungsnationalismus“ eine rein negative Bestimmung letztlich nicht aus. Es muss an etwas, das „spontan“ in den Auseinandersetzungen, Erfahrungen auftritt, angeknüpft werden, das dann die gemeinsame Identität bildet. Diese kann entweder „essentialistisch“ im biologischen Wesen, der Natur des Menschen gefunden oder muss scheinbar spontan auftretenden, in Wirklichkeit jedoch gesellschaftlich vermittelten objektiven Bewusstseinsformen entnommen werden. Im Fall Fanons ist Letzteres der kämpfende Nationalismus. Letztlich entrinnt diese „nicht-essentialistische“ Identitätspolitik den Problemen ihres Konterparts nicht, sondern ideologisiert vielmehr das Klasseninteresse der bürgerlichen Führungen der Befreiungsbewegungen der 1960er Jahre.
Ökonomismus
Neben AutorInnen wie de Beauvoir oder Fanon präsentieren einige VerteidigerInnen einer linken Identitätspolitik auch die ArbeiterInnenbewegung als eine solche. „Denn auch all jene praktischen wie theoretischen Versuche, unter den Lohnabhängigen (und über diese hinaus) Klassenbewusstsein zu formieren, sind Formen von Identitätspolitik: Schließlich ging es nicht zuletzt darum, dass die einzelnen Individuen sich kollektiv über die Arbeit und über ihre Klassenposition identifizieren.“ (Susemichel/Kastner, Identitätspolitiken, UNRAST-Verlag, Münster, 2018, S. 13)
Das Problem mit dieser Auffassung besteht aber gerade darin, dass das „spontane“, im Rahmen des Lohnabhängigkeitsverhältnisses und der Identifikation mit der Arbeit hervorgebrachte Bewusstsein längst noch kein Klassenbewusstsein darstellt – jedenfalls nicht für Marx, Lenin und andere AutorInnen der revolutionär-marxistischen ArbeiterInnenbewegung. Im Gegenteil: Marx verweist im „Kapital“ auf die Problematik des spontanen ArbeiterInnenbewusstseins. So zeigt er beispielsweise im Kapitel über den Arbeitslohn, dass die Lohnform notwendigerweise bei den KapitalistInnen wie bei den ArbeiterInnen ein verkehrtes Bewusstsein über das Klassen- und Ausbeutungsverhältnis hervorbringt.
In der kapitalistischen Produktionsweise muss der Wert der Ware Arbeitskraft notwendigerweise die Form des Arbeitslohns annehmen. Es erscheint, als würde der/die KapitalistIn nicht die Arbeitskraft kaufen, sondern die gesamte, vom/von der Lohnabhängigen für ihn verrichtete Arbeit bezahlen. Daher verschwinden mit der Lohnform auch Mehrarbeit und -wert und damit die eigentliche kapitalistische Ausbeutung im Bewusstsein von KapitalistInnen und LohnarbeiterInnen. Wie Marx zeigt, stellt dieses Verschwinden des grundlegenden Ausbeutungsverhältnisses im Bewusstsein antagonistischer Klassen ein notwendiges Resultat der kapitalistischen Produktionsweise selbst dar, eine Verkehrung, die mit der Wertform der Waren untrennbar verbunden ist. Es handelt sich bei der Lohnform also um eine objektive Gedankenform, eine Mystifikation wesentlicher Verhältnisse. Die unmittelbare Erfahrung der ArbeiterInnenklasse und der nur-gewerkschaftliche Kampf zwischen Lohnarbeit und Kapital bewegen sich innerhalb dieser Gedankenform, ja bestärken diese sogar bis zu einem gewissen Grad. Im Alltagsbewusstsein der Arbeitenden drückt sich das z. B. darin aus, dass nur schlecht bezahlte, prekäre Arbeit als „Ausbeutung“ zu einem Hungerlohn erscheint, während ein Lohn, der die Reproduktionskosten deckt oder sogar etwas höher als diese bezahlt wird, als „gerecht“ wahrgenommen wird.
Auch der rein ökonomische Klassenkampf verbleibt, wie Lenin an Marx anknüpfend in „Was tun“ deutlich macht, noch auf der Ebene des Aushandelns der Verkaufsbedingungen der Ware Arbeitskraft. Diese Auseinandersetzung kann zwar eine Schärfe erreichen, die Lohnabhängige empfänglich für revolutionäre Agitation und Propaganda macht, z. B. wenn bestimmte Kämpfe wie Streiks, die vom Staat unterdrückt werden, Fragen aufwerfen, die über den Bewusstseinshorizont der gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen hinausgehen. Dies ändert jedoch nichts daran, dass das politische Klassenbewusstsein nicht spontan in diesen Auseinandersetzungen entsteht. Es kann vielmehr, wie es Lenin ausdrückt, „dem Arbeiter nur von außen gebracht werden, das heißt aus einem Bereich außerhalb des ökonomischen Kampfes, außerhalb der Sphäre der Beziehungen zwischen Arbeitern und Unternehmern.“ (Lenin, Was tun?, LW 5, S. 436)
Wenn die ArbeiterInnenbewegung als identitätspolitische, also auf der spontanen, naturwüchsig entstehenden Identifikation mit der Arbeit, dem ArbeiterInnensein und der Lohnbewegung beruhende begriffen, ja fixiert wird, so wird hier nur der Fehler des Ökonomismus wiederholt, den gewerkschaftlichen Konflikt und dessen reformpolitische, gesetzgebende Verlängerung im Ringen gegen „soziale Ungleichheit“ zum eigentlichen ArbeiterInnenkampf zu verklären.
Das Problem besteht aber gerade darin, dass dieses spontane ArbeiterInnen- kein revolutionäres Klassenbewusstsein bilden kann, sondern eine Form bürgerlichen Bewusstseins darstellt. Dasselbe trifft auch auf eine solcherart geprägte „ArbeiterInnenidentität“ zu. Wenn wir beispielsweise die Kultur und Identität betrachten, wie sie z. B. der Austromarxismus, der „Sozialstaat“, aber auch die vom Stalinismus beherrschten Staaten hervorbrachten, so waren diese wesentlich Formen verbürgerlichter „ArbeiterInnenkultur“ und dementsprechender Identitäten. Diese gingen zwar mit der Anerkennung der LohnarbeiterInnen als gesellschaftlicher Kraft einher. Zugleich jedoch wurden mit dieser nicht nur Identifikation mit „der Arbeit“ und ein gewisser Stolz vermittelt, sondern auch ein in den gesellschaftlichen Zusammenhang eingegliedertes „ArbeiterInnensein“, das dann nicht auf die Aufhebung der ArbeiterInnenklasse (oder gar den revolutionären Sturz des Kapitalismus oder der Herrschaft einer Staatsbürokratie) abzielte. Im Gegenteil, Sozialdemokratie, Gewerkschaftsbürokratie und Stalinismus drängten und drängen danach, eine bestimmte „ArbeiterInnenkultur“ zu verewigen. Diese geht notwendigerweise mit einer Anpassung an die bürgerliche Kultur, eine Übernahme von reaktionären Elementen einher, so z. B. einer Idealisierung der bürgerlichen Familie, von reaktionären Geschlechterrollen, aber auch der jeweiligen nationalen Kultur. Wie die Identitätspolitik fassen auch Reformismus und Ökonomismus die „ArbeiterInnenidentität“ als etwas Gegebenes, Statisches.
Für den revolutionären Marxismus hingegen ist revolutionäres, das eigentliche proletarische Klassenbewusstsein grundlegend verschieden von demjenigen, das an der Oberfläche der Gesellschaft entsteht. Das spontane Bewusstsein ist ein bürgerliches. Dem Marxismus geht es darum, die ArbeiterInnenbewegung in eine Richtung zu lenken, die Verhältnisse erkämpfen kann, in denen nicht nur diese Bewusstseinsformen aufgehoben werden können, sondern vor allem die Bedingungen, die sie notwendig hervorbringen.
In der Einleitung zur „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ formuliert Marx die Forderung, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verächtliches Wesen ist“ (MEW 1, S. 385).
Die revolutionäre Kraft der ArbeiterInnenklasse besteht nicht darin, die Identität, die der aktuelle Zustand hervorbringt, einfach positiv bejahend aufzunehmen, sondern sich vielmehr als ein im Werden begriffenes Subjekt zu verstehen. Dies erfordert aber, dass die ArbeiterInnenklasse (wie auch sozial Unterdrückte) nicht bloß als bestehende Gruppe von Menschen mit ähnlichen Erfahrungen (oder auch einem/r gemeinsame GegnerIn) begriffen werden darf, sondern auch von ihrem Ziel, von ihrer Bestimmung als revolutionärer Kraft verstanden werden muss. Das Wesen der ArbeiterInnenklasse, das sie überhaupt erst zu einer revolutionären Klasse macht, besteht also nicht darin, wie sie ist, sondern wie sie werden kann und muss, um sich selbst und die gesamte Menschheit von Ausbeutung und Unterdrückung zu befreien.
Die Identitätspolitik hingegen vertritt einen statischen, aus dem Hier und Jetzt, sei es nun „essentialistisch“ oder „nicht-essentialistisch gewonnenen Begriff von Identität. Da sie Identität als etwas Gegebenes, Statisches oder Konstruiertes auffasst, verstrickt sie sich in die Dialektik des Wesens und kann zu keiner Aufhebung vorgefundener Identitäten kommen. Hier erweist sich das philosophische Verharren auf dem Empirismus, Pragmatismus, Existenzialismus, Postmodernismus oder auch einem mechanischen Materialismus als fatal.
Gegenüber diesen letztlich antidialektischen Theorien besteht der Fortschritt in der Hegel’schen Bestimmung des Wesensbegriffs gerade darin, dass es selbst als etwas erst im Entstehen Begriffenes, Nicht-Fertiges aufgefasst ist, das gerade und trotz dieser Unbestimmtheit und Offenheit der Entwicklung im Zusammenhang des Ganzen zentral für die Gesamtbewegung ist. Wie es in der Phänomenologie heißt: „Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen.“ Und weiter: Es ist „wesentlich Resultat, daß es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit ist; und hierin eben besteht seine Natur, Wirkliches, Subjekt oder Sichselbstwerden zu sein.“ (Hegel, Phänomenologie des Geistes, Werke, Bd. 3, S. 24)
Das Subjekt der Befreiung liegt daher in diesem Sinn nicht fertig vor. Seine Wirklichkeit und Erfahrungen sind vielmehr notwendig widersprüchlich und erst in Bildung begriffen. Die dekonstruktivistische Kritik am „Essentialismus“ beraubt das Subjekt gerade um das, was Voraussetzung seines Werdens als Geschichtssubjekt ist – seine Kollektivität, seinen Massencharakter –, während letztlich jede Form von Identitätspolitik verkennt, dass sich das Subjekt überhaupt erst herausbilden muss.
Genau diesen Punkt greift der Marxismus auf, wenn er von der Entwicklung der Klasse an sich zu einer für sich spricht. Als eine Klasse für sich bildet sich die ArbeiterInnenklasse jedoch nur als revolutionäre, wenn sie sich als Geschichtssubjekt der Umwälzung und Errichtung einer neuen Gesellschaftsordnung konstituiert, also die Bedingungen schafft für das Abstreifen aller reaktionären, rückschrittlichen Seins- und Bewusstseinselemente sowie ihrer Aufhebung als Klasse, ihr Aufgehen in einer vom Joch der Klassenherrschaft befreiten Menschheit. Das Ziel der revolutionären Bewegung der ArbeiterInnenschaft besteht schließlich nicht in der nachrevolutionären Verewigung als nun herrschende Klasse, sondern in der Überwindung der Klassenspaltung selbst und dem Schaffen einer klassenlosen Gesellschaft, in der erst die Menschen endgültig das Erbe ihrer Erniedrigung, Versklavung, Vereinseitigung abgeschafft haben werden.
Wurzeln der Identitätspolitik unter Unterdrückten
Abschließend wollen wir noch einige wesentliche Schlussfolgerungen unserer Betrachtung und Kritik zusammenfassen:
Erstens muss eine marxistische Kritik der linken Identitätspolitik verstehen, warum diese ideologisch so prägend werden konnte. Dies liegt zu einem guten Teil auch an den traditionell vorherrschenden Strömungen und Ideologien in der ArbeiterInnenklasse. Stalinismus, Sozialdemokratie und Gewerkschaftsbürokratie negieren letztlich die subjektiven Erfahrungen der Lohnabhängigen als handelnde Subjekte. Daher machen viele Unterdrückte, darunter auch sozial unterdrückte Teile der ArbeiterInnenklasse mit den verkrusteten, verbürokratisierten und reformistischen Führungen die Erfahrung, dass ihre Unterdrückung, ihre verstärkte Ausbeutung auch von der ArbeiterInnenbewegung nicht ernst genommen wird. Sie werden – oft nicht viel anders als in der bürgerlichen Gesellschaft – auf einen „späteren“ Zeitpunkt vertröstet, weil jetzt angeblich Wichtigeres auf der Tagesordnung stünde. Sie werden paternalistisch-wohlwollend behandelt, als Objekt, um das man sich schon kümmern würde. Ihre Subjektivität, zumal eine aktive, rebellische, gilt als suspekt. Die Tatsache, dass die ArbeiterInnenbürokratie auch alle anderen Teile der Klasse passiv und unter Kontrolle hält, kann darüber nicht hinwegtrösten.
Im Gegenteil: Die ArbeiterInnenbürokratie stützt sich in der Regel auf die relativ privilegierten Lohnabhängigen in den imperialistischen Ländern, auf die ArbeiterInnenaristokratie, die ihrerseits oft männlich, weiß, heterosexuell geprägt ist. Natürlich sind auch deren Bewusstseinsformen oft von reaktionären Ideologien – Chauvinismus, Sexismus, teilweise sogar Rassismus – geprägt. Die vorherrschende Politik der Gewerkschaften und reformistischen Parteien, sich auf rein ökonomische Kämpfe bzw. Wahlkämpfe und Sozialreform zu beschränken, bedeutet, dass der gesellschaftlich vorherrschende Bewusstseinszustand der Klasse nicht nur in Kauf genommen wird. Oft stützen sich gewerkschaftliche Apparate und reformistische Parteien direkt auf diese Formen. Im schlimmsten Fall verhalten sie sich gegenüber Kämpfen der Unterdrückten passiv oder vertreten Formen von Chauvinismus, Nationalismus, Rassismus, Sexismus, Homo- und Transphobie, wie sie auch im bürgerlichen Mainstream vorherrschen.
Daher erfordert eine politische Auseinandersetzung mit Identitätspolitik in fortschrittlichen Bewegungen einen unversöhnlichen Kampf gegen alle Formen repressiver, unterdrückerischer Politik in der ArbeiterInnenbewegung selbst. Nur so werden die besten KämpferInnen von den inneren Grenzen und der Notwendigkeit des Bruchs mit der Identitätspolitik überzeugt werden können. Nur so werden sie überzeugt werden können, dass die marxistische Kritik am bürgerlichen Charakter dieser Ideologie nichts mit einer passiven Haltung zu ihrer Unterdrückung und ihren persönlichen und kollektiven Erfahrungen zu tun hat.
Im Gegenteil, RevolutionärInnen müssen dafür kämpfen, dass diese gehört werden, diese Kraft Eingang in den Kampf findet. Eine Erscheinungsform jeder sozialen Unterdrückung wie auch der kapitalistischen Ausbeutung besteht schließlich tatsächlich darin, dass ihre Erfahrungen (und noch vielmehr spontane Formen von Rebellion, Aufbegehren und Widerstand) in dieser Gesellschaft marginalisiert werden.
Der Marxismus erkennt an, dass Subjektwerdung der Klasse auch eine viel breitere, umfassende Artikulation der Erfahrungen mit Ausbeutung und Unterdrückung beinhaltet. Die ArbeiterInnenkorrespondenzen in den Zeitungen der Zweiten und Dritten Internationale verdeutlichten auch, wie wichtig diese für die Formierung einer kämpfenden Bewegung und den kollektiven Austausch waren. Die Betonung dieser Erfahrung in der Identitätspolitik inkludiert somit ein richtiges Moment, das die ArbeiterInnenbewegung insgesamt – und zwar nicht nur hinsichtlich der Erfahrung von Lohnabhängigen, sondern aller Unterdrückten forcieren muss.
Zweitens muss die ArbeiterInnenbewegung alle fortschrittlichen Kämpfe von gesellschaftlich Unterdrückten, sei es gegen die UnternehmerInnen, den Staat oder die Rechten, sei es gegen imperialistische Ausbeutung und Besatzung, ohne Wenn und Aber unterstützen. Dass die Identitätspolitik bei vielen Auseinandersetzungen und Bewegungen eine bedeutende, wenn nicht sogar vorherrschende Ideologie spielen mag, ändert daran nichts. Es geht schließlich nicht darum, eine falsche politische Konzeption zu unterstützen, sondern die legitime Gegenwehr. Wenn die ArbeiterInnenbewegung und vor allem deren revolutionärer Flügel wirklich zeigen will, dass sie jedes Aufbegehren gegen Unterdrückung als integralen Bestandteil des Klassenkampfes um eine andere, sozialistische Gesellschaft begreift, so muss sie dies z. B. den AktivistInnen der Frauenbewegung, in antirassistischen Kämpfen, Geflüchteten, sexuell Unterdrückten auch praktisch zeigen.
Kritik der Identitätspolitik
Diese praktische Politik muss aber einhergehen mit eine unversöhnlichen Kritik der Identitätspolitik selbst. Diese geht letztlich von einem bürgerlichen Verständnis der Subjektbildung aus. Im Grunde betrachtet sie das Individuum oder Identität und damit Bewusstsein nicht als gesellschaftliches, geschichtliches, veränderbares Produkt.
Entweder tut sie das in der kruden Form, dass aus der eigenen Erfahrung/Empfindung unmittelbar auf die Richtigkeit der gesellschaftlichen Einschätzung Rückschluss gezogen wird (Teile des Feminismus, Antikolonialismus, Ökonomismus) oder diese Politik wird komplexer gedacht und begründet. So wird anerkannt, dass auch das Bewusstsein der Unterdrückten „entstellt“, vom Unterdrückungsverhältnis geprägt sein kann. Aber statt den widersprüchlichen Charakter der persönlichen und kollektiven Erfahrung selbst zu begreifen, wird auf eine eigentliche, aber dahinter liegende, weniger unmittelbare Erfahrung rekurriert, die gewissermaßen nur freigelegt werden müsse, oder es wird eine gewisse Relativierung wie im Intersektionalismus vorgenommen, wenn verschiedene Erfahrungen gegeneinander abgewogen werden.
Auch wenn die eigene bzw. kollektive Erfahrung für den Kampf gegen Ausbeutung oder Unterdrückung einen unerlässlichen Ausgangspunkt für Handeln, Rebellion, Infragestellung scheinbarer Selbstverständlichkeiten darstellt, so kann aus ihr selbst heraus sicher nie die Richtigkeit einer Analyse, eines Verständnisses des Gesamtzusammenhangs hergeleitet werden.
Im Gegenteil, im Kapitalismus kann, ja wird bei den Unterdrückten notwendig und spontan ein falsches Verständnis reproduziert werden. Das tut z. B. der bürgerliche Feminismus, indem er die Frauenunterdrückung auf eine Gleichheitsfrage reduziert; das tut der Nationalismus von Befreiungsbewegungen, denn der Nationalismus ist auch dann noch eine bürgerliche Ideologie; das tut der Ökonomismus, indem er ArbeiterInnenpolitik als Verlängerung des nur-gewerkschaftlichen Klassenkampfes betrachtet.
Für den Marxismus stellt der Mensch hingegen ein „Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse“ dar. D. h. die Individualität, auch die Identität der Einzelnen z. B. ist selbst ein historisches Produkt.
Damit ist nicht nur gemeint, dass wir in eine bestimmte Welt mit bestimmten Möglichkeiten hineingeboren worden sind. Bestimmte Klassengesellschaften bringen auch verschiedene Klassenindividuen hervor und je nach Typus spezifische objektive Gedanken- und Bewusstseinsformen, damit auch bestimmte Formen der Identität.
Aber die Identität stellt sich im Kapitalismus spezifisch dar. Und zwar selbst in doppelter Weise als bürgerliches (WarenbesitzerIn) und Klassenindividuum (Klasse an sich).
Das Bewusstsein, bestimmte Bewusstseinsformen der Individuen sind schon in der Form davon geprägt, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse in ihnen verschleiert werden, verkehrt erscheinen oder überhaupt ihr Wesen verschwindet – und zwar mit Notwendigkeit. So z. B. in der Lohnform – und das hat auch Auswirkungen auf die Frage der Hausarbeit, privaten Arbeit, damit auch des Verhältnisses zwischen den Geschlechtern.
- h. die Identität der Ausgebeuteten und Unterdrückten ist nicht einfach nur in dem Sinne „geformt“, dass sie z. B. herrschaftskonforme Stereotypen nachvollziehen (z. B. Gehorsam, moralische Werte, Geschlechternormen), sondern auch in dem, dass ihre spontanen moralischen Ziele (Gleichheit, Gerechtigkeit, …) selbst ideologische Formen darstellen und eine dem System selbst entsprechende, wenn auch widersprüchliche Identität gebildet wird. Diese enthält bewusste und unbewusste Komponenten und auch in sich widersprüchliche Momente – nicht zuletzt weil auch die Gesellschaft, deren subjektive Reflexion sie darstellt, widersprüchlich ist.
Eine nicht gesellschaftsbezogene Betrachtung führt das dazu, dass die Ungleichheit von Mann und Frau in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung als Effekt biologischer „natürlicher“ Unterschiede erscheint oder als Auswirkung eines Diskurses, Narrativs betrachtet wird.
Dieser Biologismus sitzt ebenso wie Identitätspolitik und Queerfeminismus gesellschaftlichen Oberflächenphänomen auf. Er nimmt die Identität (oder im Fall des Letzteren den Diskurs), also eine bewusstseinsmäßige Widerspiegelung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zum Ausgangspunkt, nicht die materiellen, alltäglichen Grundlagen der Gesellschaft: die herrschenden Produktionsverhältnisse.
Wenn aber die gesellschaftlichen Verhältnisse (Ausbeutung, Unterdrückung) nur vermittelt, ideologisiert im Bewusstsein und in Rollen„zuweisungen“ erscheinen können, so kann auch nicht aus der eigenen Erfahrung unmittelbar auf die Wurzeln oder die gesellschaftliche Bedeutung der eigenen Unterdrückung/Ausbeutung geschlossen werden.
Das Verhältnis von kapitalistischer Ausbeutung zu Frauenunterdrückung lässt sich aus der unmittelbaren Erfahrung nicht ableiten. So stellt das Kapitalverhältnis (und damit die Ausbeutung der Lohnarbeit) das grundlegende gesellschaftliche dar. Das bedeutet jedoch keineswegs immer, dass die Lebenslage der ArbeiterInnenklasse am schlechtesten wäre. In etlichen Ländern oder ganzen Perioden kann die der Kleinbauern/-bäuerinnen und Landlosen deutlich schlechter sein. Nichtsdestotrotz vermögen diese keine konsequent revolutionäre Kraft zu konstituieren aufgrund ihrer gesellschaftlichen Lage als, wenn auch in Auflösung begriffener, Teile des KleinbürgerInnentums.
Auch der Unterschied zwischen Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnis lässt sich nicht aus der Erfahrung erkennen und verstehen, lässt sich nicht aus der Identität der Ausgebeuteten oder Unterdrückten herleiten, weil die Identität selbst objektiv gesellschaftlich geprägt ist, also „funktionale“ unterm Kapitalismus spezifische objektive Bewusstseinsformen, Fetischformen (nicht nur im Sinn von falschen Zuschreibungen) hervorbringt.
Identitätspolitik geht nicht vom Menschen als „Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse“ aus, sondern vom Individuum. Die gesellschaftlichen Verhältnisse werden nicht als konstitutiv eingeführt, sondern bei der Analyse erst nachträglich (z. B. in Form von Kritik an Privilegien, diskursiven Zuschreibungen usw.) hinzugefügt und auch dann in der Regel auf der Ebene von Verteilungsverhältnissen, nicht des ihnen zugrundeliegenden kapitalistischen Produktionsverhältnisses und eines Verständnisses der Totalität der bürgerlichen Gesellschaftsformation.
Damit werden zwar reale Erscheinungsformen zur Kenntnis genommen und betont, aber auf einer falschen methodischen Grundlage, in der z. B. Klassenverhältnisse nur als ein weiteres Attribut von Diskriminierung und (autoritärer) Herrschaft erscheinen, nicht als grundlegendes Ausbeutungsverhältnis.
Daher kann ein Programm auf Basis der Identitätspolitik bestenfalls eklektisch sein, nicht revolutionär.
Daher muss der Marxismus Identitätspolitik grundsätzlich und in jeder Form ablehnen, insbesondere auch die Vorstellung, Klassenpolitik als eine Form der Identitätspolitik zu begreifen. Das würde bedeuten, Marxismus auf Ökonomismus zu reduzieren.
Die Ablehnung der Identitätspolitik bedeutet dabei nicht, die Wichtigkeit eigener Erfahrung und der Bedeutung kollektiver Identität abzulehnen. Im Gegenteil: Deren Betonung stellt ein wichtiges Element revolutionärer Politik dar. Aber diese kann nicht spontan zu revolutionärer Politik führen. Revolutionäres Klassenbewusstsein erfordert vielmehr eine Verbindung kollektiver Erfahrung mit dem Marxismus. Dies wiederum bedeutet den Aufbau einer revolutionären Partei und Internationale, eines internationalen Kampfverbandes der entschlossensten und bewusstesten Teile der ArbeiterInnenklasse und aller Unterdrückten auf der Basis eines Programms, dem eine wissenschaftlich fundierte Verallgemeinerung geschichtlicher Erfahrung zugrunde liegt.
Quelle: Fight! Revolutionäre Frauenzeitung… vom 13. März 2021
Tags: Arbeitswelt, Feminismus, Postmodernismus, Strategie

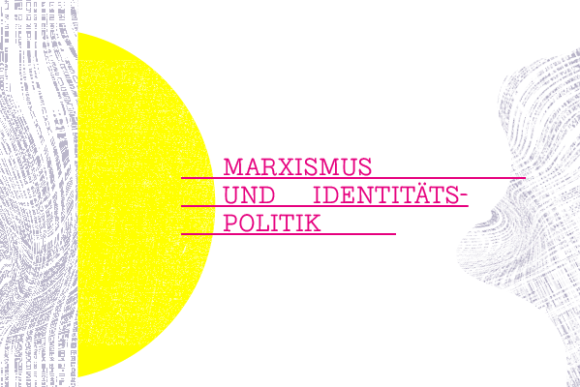








Neueste Kommentare